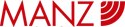Datenschutz konkret
Recht - Projekte - Lösungen
Inhaltsverzeichnis
| ISSN: | 2313-5409 |
|---|---|
| Reihe: | Dako - Datenschutz konkret |
| Verlag: | Manz Verlag Wien |
| Format: | Zeitschrift |
| Jahrgang 2019 - mehr unter http://dako.manz.at |
| DatKomm – der große Bruder der Dako | |
|
Dako 2018/59
|
|
| Datenschutz ist ein lebendes Konstrukt | |
|
Interview mit Peter Lohberger, Leiter der Rechtsabteilung und Datenschutzbeauftragter der Landesholding Burgenland.
Peter Lohberger spricht über die koordinierte Umsetzung der DSGVO in der Landesholding Burgenland und den zukunftsorientierten Umgang mit datenschutzrechtlichen Herausforderungen. |
|
|
Dako 2018/60
|
|
| Citizen Science-Projekte datenschutzkonform gestalten – ein Leitfaden (Teil 2) | |
|
Drittland; Nutzerverwaltung; Einwilligungserklärung; Betroffenenrechte.
Welche datenschutzrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf teilnehmende Citizen Scientists müssen Citizen Science-Projekte einhalten? Nachdem der erste Teil des Beitrags datenschutzrechtliche Grundlagen erläutert hat, bietet der zweite Teil einen praxisnahen Leitfaden zur datenschutzkonformen Gestaltung eines Citizen Science-Projekts. |
|
|
Dako 2018/61
|
|
| EuGH C-210/16: Steht der digitale Unternehmensauftritt vor dem Aus? | |
|
Besprechung von EuGH 5. 6. 2018, C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (Teil 2).
Der eigene Unternehmensauftritt in sozialen Medien ist in der heutigen Zeit unabdingbar. Der EuGH könnte mit dem Urteil die Regeln dafür neu geschrieben haben. Der erste Teil des Beitrags (Dako 2018/45) befasste sich mit den rechtlichen Fragen; der zweite erläutert die Bedeutung für die Praxis. |
|
|
Dako 2018/62
|
|
| Keine Verjährung für die Verhängung von Geldbußen | |
|
Verjährungsprivileg; Verfolgungsverjährung; Verjährungsfrist; Kumulationsprinzip.
Der Beitrag zeigt die Folgewirkungen eines VwGH-Erkenntnisses aus dem Vergaberecht zur Verjährung im Datenschutzrecht. |
|
|
Dako 2018/63
|
|
| Das Sanktionsregime der DSGVO bei Verstößen gegen den Datenschutz | |
|
Das neue EU-Datenschutzrecht – Teil 15.
Wem drohen welche Sanktionen und – vor allem – in welcher Höhe? Dass der DSGVO weltweit so viel Aufmerksamkeit zuteil wird, liegt wohl nicht nur an dem gestiegenen Interesse an Privatsphäre und Schutz von Daten (Stichwort „Facebook“ und „Cambridge Analytica“), sondern va an den Strafen in Millionenhöhe, welche bei Verstößen gegen das neue Datenschutzrecht drohen. |
|
|
Dako 2018/64
|
|
| Datenschutzrechtliche Zulässigkeit von Background-Checks bei Bewerbern | |
|
Security- und Risikomanagement; internes Kontrollsystem; Fürsorgepflicht.
Dieser Beitrag nimmt Bezug auf die Beiträge von Dolamic (Background-Checks bei Bewerbern, Dako 2017/65) und die Replik von Hitz (Internet-Recherchen über BewerberInnen – warum und in welcher Form Backgound-Checks doch möglich sind, Dako 2018/8). In den folgenden Zeilen werden Standpunkte des Security- und Risikomanagements in die Diskussion eingebracht und dargelegt, in welchen Fällen die Verarbeitung von Daten, die durch Background-Checks gewonnen werden, als erforderlich anzusehen ist und wie umfangreich die Verarbeitung durchgeführt werden darf. |
|
|
Dako 2018/65
|
|
| Erste Entscheidung der DSB zu Speicherfristen: Welche Rolle spielt die Interessenabwägung? | |
|
Besprechung von DSB-D216.471/0001-DSB/2018 und der Rechtslage außerhalb des TKG.
Die Datenschutzbehörde (DSB) hat infolge der Beschwerde einer betroffenen Person ausgesprochen, dass ein Betreiber eines Telekommunikationsdiensts das Recht der Betroffenen auf Geheimhaltung dadurch verletzt hat, dass dieser personenbezogene Daten über den zulässigen Zeitraum hinaus speicherte. Gegen diese E wurde kein Rechtsmittel eingelegt, sodass sie in Rechtskraft erwachsen ist. In der Datenschutzpraxis führte diese E zu Vermutungen, die DSB würde damit eine generelle, sehr restriktive Haltung in Bezug auf legitime Aufbewahrungsdauer und -zwecke einnehmen. Der vorliegende Beitrag zeigt, warum diese E nicht verallgemeinerungsfähig ist und bei der Betrachtung dieser Themen Umsicht und Differenzierung geboten sind. |
|
|
Dako 2018/66
|
|
| Rechtsprechung | |
|
Strafbarkeit der juristischen Person.
Das BVwG hegt in der Entscheidung Bedenken gegen die Möglichkeit, die juristische Person direkt mit einer Geldstrafe zu belegen. Nach Ansicht des BVwG in der Begründung der Zulässigkeit der Revision stellt sich die Frage, ob das bei der Bestrafung der juristischen Person anzuwendende System ein zweistufiges Prüfsystem verschreibt.§ 30 DSG; § 5 Abs 1, § 9 VStG; § 5 Abs 1a VStG ab 1. 1. 2019
BVwG 25. 6. 2018, W210 2138108-1
|
|
|
Dako 2018/67
|
|
|
Anwendbares Recht, Ermittlungsbefugnis von Behörden im Verwaltungsverfahren.
Denkmöglichkeit der Beweismittelerhebung.Art 6 Abs 1 lit e DSGVO iVm § 34 NÖ BauO 2014 iVm § 54 AVG
BVwG 11. 7. 2018, W214 2183935–1
|
|
|
Dako 2018/68
|
|
|
Zeitpunkt der Beurteilung des anwendbaren Rechts.
Auch das BVwG hat bereits das neue Datenschutzregime anzuwenden.§ 69 Abs 4 DSG
BVwG 3. 7. 2018, W258 2192861–1
|
|
|
Dako 2018/69
|
|
|
Löschfristen.
Die Speicherung von Bewerberdaten für die Dauer von sieben Monaten ist gerechtfertigt, angemessen und verhältnismäßig.Art 5, 17 DSGVO
DSB 27. 8. 2018, DSB-D123.085/0003-DSB/2018
|
|
|
Dako 2018/70
|
|
| Buchtipp | |||||
|
|||||
|
|||||
| JUDIKATUR | |
| Update: Anwendbares Recht beim BVwG | |
| „Recht auf Vergessenwerden“ – Räumlicher Anwendungsbereich | |
| Anonymisierung von EuGH-Urteilen | |
| Entscheidung des OGH zum Koppelungsverbot | |
| LEGISLATIVE | |
| Kundmachung Black List | |
| VERWALTUNG | |
| Neue Zahlen zur Auslastung der DSB | |
| 3. Vollversammlung des EDSA | |
|
Dako 2018, 120
|
|